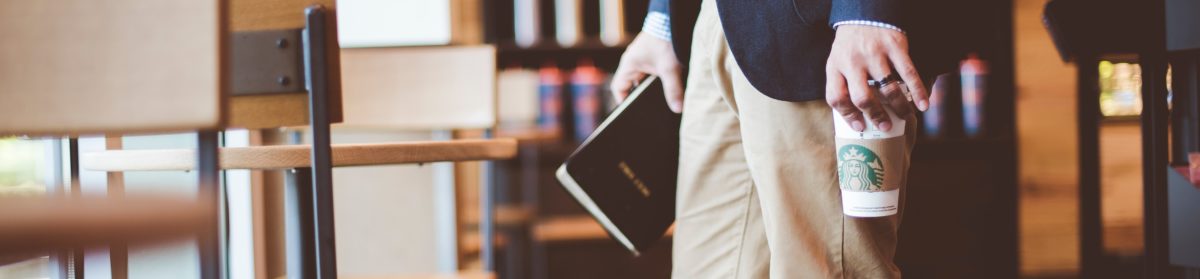Predigt vom 18.01.2026 in der EMK Adliswil zu Offenbarung 21,1–7 u.a.

Copyright: Joshua Earle on unsplash.com
Liebe Gemeinde,
am Feierabend vor dem TV: Du schaust einen schönen Film. Oder eine interessante Dokumentation. Oder eine spannende Sportübertragung. Da leuchtet plötzlich unten ein grelles rotes Band auf. Von links wandert ein Text ins Bild, der beginnt mit ‚Breaking News’. ‘Nine-eleven‘ war wohl das erste Ereignis, bei dem ich das wahrnahm. Immerhin bald 25 Jahre her. Seither immer wieder: Wegen des grossen Tsunamis; Krieg in Nahost, Krieg in der Ukraine, Katastrophen … immer wieder: Breaking News. Ich zucke innerlich zusammen, wenn ich das Schriftband sehe. Denn gute Nachrichten sind es ja nie, die so verbreitet werden. In einer Welt voller Breaking News sind die Aussichten trübe!
„Himmlische Aussichten (Gute Nachricht II)“ weiterlesen